Lanzarote Allgemeine Informationen zu Lanzarote Tourismus Unesco-Biosphärenreservat Cochenillezucht Lippenstifte Acatife - Musik aus Lanzarote, Inselgestalter Cesar Manrique Die Salinen von Janubio Dromedar Vulkanausbruch von 1730 Weinbau
Wandel durch Tourismus
Der Tourismus, der in den sechziger Jahren auf Lanzarote Einzug hielt, hat den Conejeros, wie die|
Die kleinste der Ostkanarischen Inseln(795km, 78000 Ew.) beeindruckt mit 300 Vulkanen und einer kontrastreichen Landschaft in Schwarz, Weiß, Grün. Dazu hat Cesar Maniques künstlerischer Elan Lanzarote allerorten geprägt: In den Hölen bei Arrieta, in Mirador del Rio mit herrlichem Blick auf die Inselwelt um Graciosa, im Kakteengarten von Guatiza. Historisches Ambiente bietet die frühre Inselhauptstadt Teguise mit Burgmuseum, alten Klöstern, prächtigen Herren- häusern und urigen Tavernen. Zwischen Arrecife, dem bedeutendsten Fischereihafen der Kanarischen Inseln und der jungen Feriensiedlung Playa Blanca Sur mit Lanzarotes schönsten Naturstränden ganz in der Nähe liegt der wohl Interessanteste Teil der Insel: die Feuerberge, von denen zwischen 1730 und 1736 die größte Eruptionsphase in neuerer Zeit ausging. Ein Viertel des Lavameers gehört heute zum Nationalpark von Tinanfaya. Und aus dem verschütteten Ackerland entstand dank außergewöhnlicher Anbaumethoden eine einzigartige Agrarlandschaft. |
|||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Unesco-Biosphärenreservat
Zum weiteren Schutz der natürlichen Schönheit der Vulkaninsel und ihres kulturellen Erbes wurde Lanzarote im Oktober 1993 von der Unesco zum Biosphärenreservat erklärt. Eine Auszeichnung, die bestehende Werte würdigt und die Verpflichtung auferlegt, das wirtschaftliche Wachstum verantwortungsbewußt und umweltgerecht zu fördern. Ein Trapezakt, für den viel guter Wille und Fingerspitzengefühl nötig sind. Zu den dringendsten Anliegen Lanzarotes gehören nun neben der Kontrolle des touristischen Wachstums, der Ausbau alternativer Energiequellen und die Entwicklung eines umweltfreundlichen Abfallentsorgungskonzepts.
Opuntien zur Cochenillezucht
Viele Jahrhunderte lang bot die Landwirtschaft die Lebensgrundlage der Insulaner. Noch Mitte des 19. Jahrhunderts waren zum Beispiel weite Teile Lanzarotes, wie auch Teneriffas und Gran Canarias, von Nopalpflanzungen bedeckt, auf denen man die Cochenille Schildlaus kultivierte. Die aus dem Insekt zu gewinnende Karminsäure fand als roter Naturfarbstoff in der europäischen Textilindustrie lukrative Absatzmärkte. Nopal oder Opuntie, wie der stachelige Feigenkaktus genannt wird , und der auf ihm lebende Parasit stammen aus Mittelamerika und wurden in den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts auf die Kanarischen Inseln gebracht. Das einträgliche Geschäft erreichte zwischen 1360 und 1370 seinen Höhepunkt. Mit Entdeckung der chemischen Anilinfarben sanken jedoch ab 1330 die Preise, und die Zucht wurde langsam eingestellt. Nur auf Lanzarote findet man noch Opuntienfelder mit Cochenillezucht. Produktion und Nachfrage sind in den letzten 25 Jahren wieder angestiegen ebenso die Kilopreise: von 1900 auf 15000 Pesetas zwischen 1971 und 1996.
Rot für Lippenstifte
Im Nordosten Lanzarotes, rund um die Dörfer Guatiza und Mala, sind jetzt
wieder über 200 Hektar mit Feigenkakteen bepflanzt, auf deren fleischigen
Blättern die vier bis sechs Millimeter langen Schildläuse sitzen. In
den Sommermonaten schaben Feldarbeiter die Schmarotzer, die sich vom Saft der
Wirtspflanze ernähren und mehrmals jährlich fortpflanzen, von den
Kakteen. Die Läuse werden auf einem Holzsieb verteilt, durch kräftiges
Schütteln getötet, einige Tage in der Sonne getrocknet, gereinigt und
für den Export in luftdurchlässige Säcke gefüllt. Die
Karminsäure wird heute vor allem in der Lebensmittel- , Pharma- und
Kosmetikindustrie verwendet. Hauptabnehmer sind Italien, England und Frankreich
Acatife - Musik aus Lanzarote
Eine gemütliche Taverne im Zentrum von Teguise trägt den altkanarischen Namen Acatife, und so heißt auch eine der erfolgreichsten Musikgruppen Lanzarotes, zu der 25 Musiker zwischen 16 und 43 Jahren gehören. Das Repertoire der 1983 gegründeten Gruppe umfaßt eigene Kompositionen, wiederentdeckte Stücke traditioneller Musik und viele Folklore-Varianten, darunter die beliebten Cantos de Lanzarote. Tourneen durch Spanien, Deutschland und Frankreich brachten der Gruppe viel Erfolg. Wer Glück hat, kann sie auch auf Lanzarote in ihren traditionellen Trachten mit dunkel grauen Hosen, weißen blusenartigen Hemden, schwarzem Gürtel und Halstuch sowie schwarzen Stiefeln bei einem Auftritt erleben. Zu ihren Instrumenten gehören verschiedene Schlaginstrumente, Gitarren, Mandolinen, Baß und selbstverständlich das kanarische Zupfinstrument parexcellence: der Timple.
Teguise und die Timples
Teguise gilt als Wiege der Timples, dieser kleinen, kaum mehr als 100 Gramm wiegenden, gitarrenähnlichen Zupfinstrumente mit vier oder fünf Saiten, die überall zum Kauf angeboten werden. Noch heute gibt es in Teguise mehrere Timplewerkstätten. Einer der alteingesessenen Timplebauer ist Esteban, der in seiner geräumigen Werkstatt aus verschiedenartigsten Hölzern millimeterdünne Platten schneidet. Besonders das Holz des Maulbeerbaums wird gern verarbeitet, aber auch Nußbaum, Palisander oder Kiefernholz finden Verwendung. Für die filigranartigen Verzierungen des Gehäuses mit winzigen Perlmuttsplittern, Ebenholz- und Elfenbeinwürfeln sind Pinzette und Lupe unerläßlich. Diese Einlegearbeiten sind eine wahre Sisyphusarbeit, und ihre Güte bestimmt entscheidend den Preis des Instruments. Die heutzutage serienmäßig hergestellten, schmucklosen Modelle sind schon für hundert Mark zu haben. Einem Vergleich mit den Meisterwerken Estebans, die mehrere tausend Mark kosten können, halten sie natürlich nicht stand.
Inselgestalter Cesar Manrique
Architektonische Wunderwerke schuf Cesar Manrique auf Lanzarote, der mit seinem Design den Geschmack unserer Tage voll getroffen hat. Im April 1919 in Arrecife geboren, entdeckte der Künstler schon früh seine Liebe zur Natur, schlugen ihn die Farben und Formen seiner Heimat in ihren Bann. Früher als ihre kanarischen Nachbarn erkannten die Lanzarotenos den Wert der Erhaltung ihrer Kultur und Umwelt nicht ohne den entscheidenden Einfluß Manriques, der sich für die Bewahrung der Natur und der traditionellen Bauweise seiner Insel einsetzte. Der facettenreiche Künstler hatte in Madrid studiert und war später nach New York gegangen, wo er 1966 in sein Tagebuch schrieb: Ich denke mehr denn je an die Insel, ich glaube, daß dort mein Platz auf Erden ist ... Einige Monate später kehrte er für immer nach Lanzarote zurück, baute sich ein Haus im Lavafeld von Tahiche und begann mit der Realisierung seiner berühmtesten Bauwerke, die heute über die ganze Insel verstreut sind und Besucher aus aller Welt faszinieren : von der 1968 gestalteten Vulkanhöhle Jameos del Agua über den bewußt schlicht gehaltenen Höhlenkomplex Cueva de los Verdes gleich in der Nachbarschaft, den Anfang der siebziger Jahre in einem ehemaligen Militärposten eingerichteten Aussichtspunkt Mirador del Rio am Rand des Famara-Kliffs bis zu seinem letzten Werk, dem 1990 eröffneten Kakteengarten in Guatiza. Kein anderer hat es verstanden, Architektur, Kunst und Natur so harmonisch miteinander zu verbinden wie er. Viele seiner Projekte blieben unvollendet. Aber der Geist des 1992 bei einem Autounfall tragisch ums Leben gekommenen Künstlers, der Lanzarote zu einem Kunstwerk unter freiem Himmel gemacht hat, lebt überall weiter.
Die Salinen von Janubio

Zu den modernen Anlagen gehören die Salinen von Janubio, bei denen es sich
um die größten heute noch funktionierenden Salinen der Kanarischen
Inseln handelt. Sie wurden Anfang des 20. Jahrhunderts auf einer Fläche von
440 000 Ouadratmetern rund um eine salz und jodreiche Lagune angelegt und
erreichten in den vierziger Jahren eine maximale Jahresproduktion von 13000
Tonnen Salz. Noch in den fünfziger jahren arbeiteten hier bis zu 150
Salzarbeiter - die meisten kamen aus dem Dorf Femes. Heute helfen nur noch
fünf Personen bei der sommerlichen Salzernte. Obwohl die Salinen keine
wirtschaftliche Bedeutung mehr haben, macht ihr ökologischer Wert und
landschaftlicher Reiz sie zu einem schützenswerten Teil der Insellandschaft.
Inselbewohner Dromedar
Morgens früh um sieben Uhr treten rund 260 Dromedare ihren Weg zur Arbeit an. Ihr Arbeitsplatz: die Dromedarstation Echadero de Camellos am Rand der Feuerberge. Ihre Kunden: Touristen aus den Feriengebieten Costa Teguise, Puerto del Carmen und Playa Blanca, die auf dem harten englischen Stuhl, einem Holzgestell, das am Bauch der geduldigen Wüstentiere festgezurrt wird, einen schaukeligen Ritt von zwanzig Minuten am Hang des Timanfaya unternehmen. 52 Camelleros, Kameltreiber, arbeiten in der Dromedarstation, jeder betreut eine Gruppe von etwa fünf Kamelen. Bei den meisten Tieren handelt es sich um Kamelstuten, die weitaus umgänglicher sind als die männlichen Wiederkäuer. Nach getaner Arbeit kehren die Dromedare am Nachmittag in ihre Gehege in Uga, Yaiza oder Playa Blanca zurück, wo sie mit Getreide, Mais und Zwiebeln gefüttert werden und im Sommer jeden Abend bis zu vierzig Liter Wasser trinken.

Fesselnde Lanzarote-Lektüre
In seinem Haus bei Tias schreibt der kanarische Bestseller-Autor Alberto Vazquez Figueroa an seinen Abenteuerromanen, die so fesselnd sind, daß man sie kaum aus der Hand legen kann. So auch die als deutsches Taschenbuch unter gleichem Titel erschienene Trilogie Oceano-Yaiza-Maradentro, deren erster Teil die dramatische Lebensgeschichte der Fischerfamilie Perdamo aus Playa Blanca beschreibt. Zu einer Zeit, als es in dem winzigen Küstenort noch keine Hotels, sondern nur wenige Hütten gab, als die Feuerberge noch nicht von Ausflugsbussen angesteuert und die Dromedare noch zum Wassertragen benutzt wurden kurz, als Tourismus auf der Vulkaninsel noch ein Fremdwort war. Kaum eine andere Beschreibung zeichnet wohl ein so eindrucksvolles Bild von Land und Leuten, alten Traditionen und sozialen Verhältnissen der Insel ideal zur Vorbereitung des Lanzarote-Urlaubs.
Der Vulkanausbruch von 1730
Don Andres Lorenzo Curbelo, Pfarrer von Yaiza, schildert die Nacht vom 1 . September 1730 folgendermaßen: Zwischen 9 und 10 Uhr abends öffnete sich plötzlich bei Timanfaya, zwei Meilen von Yaiza entfernt, die Erde. In der ersten Nacht erhob sich ein riesiger Berg aus dem Schoß der Erde und aus dem Gipfel entwichen Flammen, die 19 Tage lang brannten. So beginnt der einzige schriftliche Bericht über eine Eruptionsphase, die während sechs langer Jahre die Einwohner Lanzarotes in Angst und Schrecken versetzte und die Gestalt der Insel vollkommen verändern sollte. Die Vulkanausbrüche von 1730 bis 1736 begruben eine Fläche von 174 Quadratkilometern, fast ein Viertel der Inseloberfläche, unter Lava und Lapilli und ließen 32 neue Vulkankrater entstehen.
Ergiebiger Timanfaya
Die Lavamassen ergossen sich rund um den Kern der Montana de Timanfaya, begruben
Dörfer, Äcker, Weiden und Felder. Die Lava verbreitete sich in diesem
Gebiet nach Norden, anfangs so schnell wie 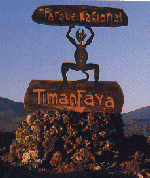 Wasser, danach verminderte sich ihre Geschwindigkeit, und sie floß zäh
wie Honig. Aufgrund des stinkenden Qualmes lag nach einigen Tagen alles Vieh tot
auf der Erde, die Vögel fielen vom Himmel, eine große Zahl von toten
Fischen schwamm auf der Oberfläche des Meeres, schrieb Pfarrer Curbelo in
seinem Tagebuch. Nach einem Jahr war noch immer kein Ende der
Vulkanausbrüche abzusehen. Die Bewohner des Inselsüdens, der
Verzweiflung nah, wanderten auf die Nachbarinseln aus. Viele fanden auch im
Norden der Insel, zum Beispiel in Los Valles bei Teguise, eine neue Heimat. Weit
über ein Drittel des Lavameers der Vulkanausbrüche von 1730 bis 1736
bildet heute den 50 Quadratkilometer großen Parque Nacional de Timanfaya.
Eine Holztafel mit Teufelsfigur markiert den Nationalparkeingang.
Wasser, danach verminderte sich ihre Geschwindigkeit, und sie floß zäh
wie Honig. Aufgrund des stinkenden Qualmes lag nach einigen Tagen alles Vieh tot
auf der Erde, die Vögel fielen vom Himmel, eine große Zahl von toten
Fischen schwamm auf der Oberfläche des Meeres, schrieb Pfarrer Curbelo in
seinem Tagebuch. Nach einem Jahr war noch immer kein Ende der
Vulkanausbrüche abzusehen. Die Bewohner des Inselsüdens, der
Verzweiflung nah, wanderten auf die Nachbarinseln aus. Viele fanden auch im
Norden der Insel, zum Beispiel in Los Valles bei Teguise, eine neue Heimat. Weit
über ein Drittel des Lavameers der Vulkanausbrüche von 1730 bis 1736
bildet heute den 50 Quadratkilometer großen Parque Nacional de Timanfaya.
Eine Holztafel mit Teufelsfigur markiert den Nationalparkeingang.
Weinbau der besonderen Art
 Dichter und Schriftsteller wie Scott und Gongora haben die kanarischen
Weine in ihren literarischen Werken verewigt. Shakespeare sagte, daß der
Malvasia-Wein die Sinne erfreut und das Blut parfümiert. Zwischen dem 16.
und dem 18. Jahrhundert entwickelte sich der Weinexport zu einem blühenden
Geschäft. Manche Jahre wurden über 15 Millionen Liter verschifft, und
die Weinausfuhr entwickelte sich zu einer der wichtigsten Einnahmequellen des
Archipels. Auf Lanzarote fiel die Blütezeit des Weinbaus in einen
späteren Zeitraum. Erst nach den schrecklichen Vulkanausbrüchen im 18.
Jahrhundert entwickelten die Bauern im Gebiet von La Geria ein besonderes System,
um Weinreben auf dem Lavaboden pflanzen zu können. In mühevoller Arbeit
graben sie bis zu zwei Meter tiefe Trichter ins Lava gestein, um so bis zum
fruchtbaren Erdreich vorzustoßen. In jeden Trichter pflanzen sie einen bis
drei Weinstöcke, die von locker aufgeschichteten, halbkreisförmigen
Steinmauern geschützt werden.
Dichter und Schriftsteller wie Scott und Gongora haben die kanarischen
Weine in ihren literarischen Werken verewigt. Shakespeare sagte, daß der
Malvasia-Wein die Sinne erfreut und das Blut parfümiert. Zwischen dem 16.
und dem 18. Jahrhundert entwickelte sich der Weinexport zu einem blühenden
Geschäft. Manche Jahre wurden über 15 Millionen Liter verschifft, und
die Weinausfuhr entwickelte sich zu einer der wichtigsten Einnahmequellen des
Archipels. Auf Lanzarote fiel die Blütezeit des Weinbaus in einen
späteren Zeitraum. Erst nach den schrecklichen Vulkanausbrüchen im 18.
Jahrhundert entwickelten die Bauern im Gebiet von La Geria ein besonderes System,
um Weinreben auf dem Lavaboden pflanzen zu können. In mühevoller Arbeit
graben sie bis zu zwei Meter tiefe Trichter ins Lava gestein, um so bis zum
fruchtbaren Erdreich vorzustoßen. In jeden Trichter pflanzen sie einen bis
drei Weinstöcke, die von locker aufgeschichteten, halbkreisförmigen
Steinmauern geschützt werden.
 Kulturlandschaft im Lavameer
Kulturlandschaft im Lavameer
Die so angelegten Vulkanmulden speichern nicht nur die Feuchtigkeit, sondern
schützen die Weinreben vor Wind und haben darüber hinaus Lanzarotes
Lavameer in eine interessante Kulturlandschaft verwandelt. Die über 1000
Weinbauern und zehn Weinkellereien, darunter die Bodegas Barreto, El Grifo und
Mozaga, die sich im Consejo regulador von Lanzarote zusammengeschlossen haben,
steigern ihre Produktion jährlich: 1996 wurden über 1 600 000 Flaschen
abgefüllt, und Lanzarotes herkunftsgeschützten Weine werden auch auf
den Nachbarinseln immer beliebter. Denn mit einem Gläschen Malvasia Wein
kann man am schönsten den Tag ausklingen lassen.
Salz zur Fischkonservierung
Die zurückgegangenen Fangquoten und das Haltbarmachender Fische per Tiefkühlung ließen das florierende Geschäft mit der Salzgewinnung zusammenbrechen. Lanzarote besitzt die ältesten Salinen des gesamten Archipels. Am Fuß vom Risco de Famara im Norden der Insel sollen bereits die Römer Salz aus dem Meer gewonnen haben. Damals sammelte man Meersalz in Felsmulden oder Naturbecken aus Tonerde. Im 19. Jahrhundert, als der Hafen Puerto Naos von Arrecife an Bedeutung gewann und die dort beheimatete Fischfangflotte immer größere Salzmengen zur Konservierung von Sardinen und anderen Fischen benötigte, nahm die Salzgewinnung einen großen Aufschwung. An der Küste der Insel entstanden immer mehr künstlich angelegte Salinen, in deren sauberen Natursteinbecken ein sehr reines Salz erzeugt werden konnte.
